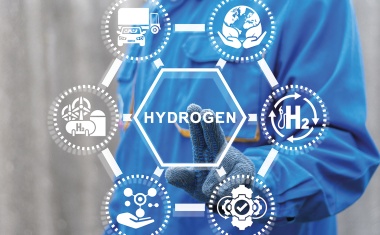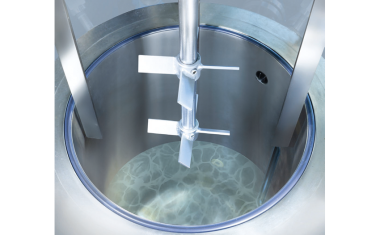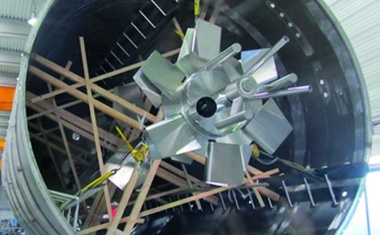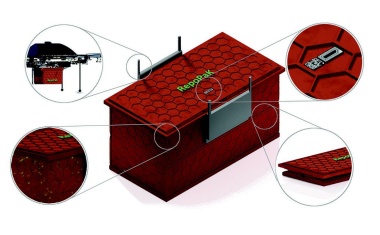Kunststoffpyrolyse ergänzt mechanisches Recycling – technologische und ökonomische Voraussetzungen schaffen
Kunststoffpyrolyse wandelt schwer verwertbare Abfälle in Rohstoffe um, kann aber mechanisches Recycling nicht ersetzen. Dechema sieht Potenzial als Ergänzung trotz technischer und regulatorischer Hürden.